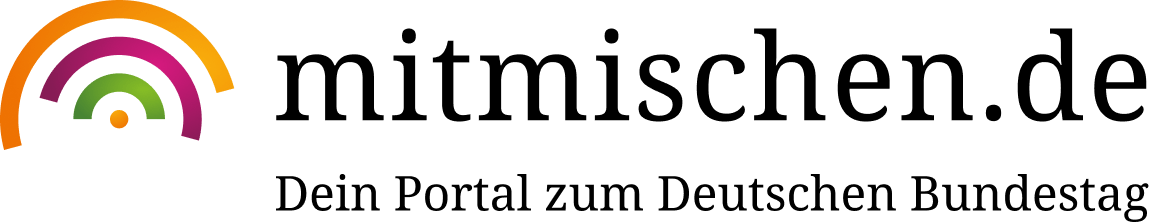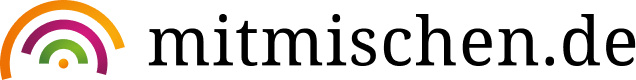Gesetzentwurf Intersexuelle Kinder besser schützen
Daniel Heinz
Weder Junge noch Mädchen, aber irgendwie auch beides – intersexuelle Neugeborene und Kinder sollen künftig nicht mehr „geschlechtsangleichend“ operiert werden dürfen. Das beschloss kürzlich der Bundestag. Was hat es damit auf sich?

Intersexuelle sind weder männlich noch weiblich – für sie gibt es die Kategorie „divers“. © shutterstock.com/Juanje Garrido
Kategorien finden wir überall. Sie lassen uns die komplexe Welt in einfache Worte fassen: Jung und alt, gut und schlecht, schwarz und weiß.
Aber manchmal ist es nicht so einfach, alles trennscharf zu unterscheiden. Selbst dann nicht, wenn es um die Kategorien männlich und weiblich geht: Denn nicht jeder Mensch wird mit Geschlechtsmerkmalen geboren – wie einem Penis und Hoden oder einer Vagina und Gebärmutter, die sich eindeutig der Kategorie Mann oder Frau zuordnen lassen. Dieser Zustand wird Intersex oder auch Intergeschlechtlichkeit genannt.
Inter- was?
Intersexualität heißt, dass alle körperlichen Geschlechtsmerkmale zusammengenommen weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuzuordnen sind. Laut Bundesverfassungsgericht leben etwa 160.000 intersexuelle Personen in Deutschland. Studien zufolge ordneten sich viele von ihnen aber dennoch einem Geschlecht zu.
Intersexuell kann auch bedeuten, dass die Geschlechtsmerkmale zwar vorhanden, aber sehr unterschiedlich ausgeprägt sind: Zum Beispiel kann die Klitoris eines Mädchens oder einer Frau auf Größe eines Penis heranwachsen. Oder jemand kann sowohl weibliche als auch männliche Organe haben. Intersexualität muss nicht immer sichtbar sein, etwa wenn der Körper eines Mädchens oder einer Frau übermäßig viel Testosteron produziert. Testosteron ist ein weibliches und männliches Sexualhormon, das aber bei Männern in viel größeren Mengen vorhanden ist. Man nennt dieses Phänomen Adrenogenitales Syndrom (AGS).
Solche Intersex-Kinder oder intergeschlechtlichen Kinder wurden in der Vergangenheit häufig operiert, sodass sie entweder dem weiblichen oder dem männlichen Geschlecht entsprachen. Ein solcher Eingriff kann nicht rückgängig gemacht werden und für Betroffene traumatische Folgen haben. Nämlich dann, wenn sie gar nicht in der Geschlechterrolle, die ihnen von Eltern und Ärzten zugewiesen wurde, leben möchten.
Schutz der geschlechtlichen Selbstbestimmung
Ohne medizinische Notwendigkeit dürfen Kinder und Neugeborene künftig nicht mehr operativ dem männlichen oder weiblichen Geschlecht angepasst werden.
Das „Verbot zielgerichteter geschlechtsangleichender Behandlungen von Kindern mit Varianten der Geschlechtsentwicklung“ soll das Recht auf „geschlechtliche Selbstbestimmung“ dieser Kinder schützen. So steht es in einem Gesetzentwurf der Bundesregierung, der Ende März im Bundestag angenommen wurde. Ja zum Entwurf sagten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und SPD. Nein sagte die AfD-Fraktion, die anderen Oppositionsfraktionen enthielten sich. Unter den Abgeordneten der Opposition herrschte Uneinigkeit: Den einen geht der Gesetzentwurf nicht weit genug, die anderen warnen vor den Folgen eines Operationsverbots.
Bundesregierung rechnet mit 150 Fällen pro Jahr
Zukünftig sollen sogenannte geschlechtsangleichende Operationen nur noch mit wenigen Ausnahmen durchgeführt werden dürfen. Etwa dann, wenn der Eingriff nicht aufgeschoben werden kann, bis das Kind selbst darüber entscheiden kann. Ein solcher Eingriff bedarf dann grundsätzlich einer Genehmigung durch ein Familiengericht. Das heißt, ein Richter oder eine Richterin muss dem Eingriff zustimmen. Dafür müssen die Eltern durch ein Expertenkomitee, bestehend aus Ärzten, Pädagogen und anderen Fachleuten, nachweisen, dass ein solcher Eingriff absolut notwendig ist.
Auch hier soll es eine Ausnahme geben: Die familiengerichtliche Genehmigung braucht es nicht, wenn die Gesundheit oder gar das Leben des Kindes gefährdet ist. Die Bundesregierung rechnet mit rund 150 Verfahren pro Jahr.
SPD: „Genauso selbstbestimmt wie jeder andere“
Bei der Debatte im Bundestags war Karl-Heinz Brunner von der SPD-Fraktion erster Redner. Er stellte den Entwurf der Bundesregierung vor und leitete das Thema ein mit der allgegenwärtigen Frage an schwangere Frauen, ob es denn ein Junge oder ein Mädchen werde. Denn die Oma oder Tante hätten vielleicht schon rosa oder blaue Sachen gestrickt.
„Aber Fakt ist, dass rund 160.000 Kinder in dieser Bundesrepublik mit nicht eindeutigen Geschlechtsmerkmalen geboren" worden seien und "das Recht haben, genauso glücklich, genauso selbstbestimmt, genauso frei wie jeder andere in diesem Land zu leben“, so Brunner. Er sei froh, dass mit diesem Gesetz deutlich gemacht werde, dass alle Menschen in diesem Land die gleichen Rechte hätten.
AfD: „Unterlassene Hilfeleistung“ bei Betroffenen
Die Fraktion der AfD sieht im Gesetzentwurf eine Diskriminierung von Mädchen mit Adrenogenitalen Syndrom (AGS), also der Kondition, bei der beispielsweise Testosteron in erhöhter Menge produziert wird.
Es sei „gewissermaßen eine unterlassene Hilfeleistung“ diesen Mädchen nicht zu helfen, so Martin Reichardt für seine Fraktion. Denn die Bundesregierung verhöhne diese Mädchen, „wenn sie sie aus ideologischen Gründen mit einem zwischengeschlechtlichen Genital aufwachsen lässt“, so Reichardt.
CDU/CSU: Operation ist selbstbestimmt möglich
Paul Lehrieder (CDU/CSU) wies in seiner Rede darauf hin, dass auch weiterhin Mädchen mit AGS behandelt werden könnten und dass diese Kinder „kerngesund das Licht der Welt erblicken, aber weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet werden können“.
Sollten sich die Kinder in ihrem späteren Leben für eine Operation entscheiden, stünde es ihnen offen. Das Verbot ende mit der Einwilligungsfähigkeit des Kindes. Lehrieder weiter: Damit erhalte das Kind „die notwendige Zeit und Möglichkeit, mit sich und seiner Umwelt die nötigen Erfahrungen zu sammeln, um seine eigene, selbstbestimmte Entscheidung treffen zu können“.
FDP: Gesetzentwurf ist „erschreckend undurchdacht“
Die FDP kritisierte den Gesetzentwurf als „nicht ausreichend“. Zum einen sei das Schutzniveau zu gering. Zum anderen sei der Entwurf „erschreckend undurchdacht“.
Katrin Helling-Plahr von der FDP-Fraktion fragte, „wie wird sichergestellt, dass das Verbot nicht durch eine zu enge Auslegung des Begriffs ‚Kinder mit Varianten der Geschlechtsentwicklung‘ umgangen wird? Was ist mit hormonellen und medikamentösen Behandlungen? Wo ist der Beratungsanspruch?“ So sei das Gesetz „lieblos“, „kompliziert“ und schütze nicht ausreichend.
Linke: Zu viele Hintertüren
Die Perspektive einer Betroffenen nahm Doris Achelwilm von der Linksfraktion ein. Sie verlas die Aussagen einer Person, die bis zum elften Lebensjahr regelmäßig Operationen hatte und die Kindheit mit Krankenhausaufenthalten verbrachte: „Ich hatte oft Schmerzen, war traumatisiert. Und auch jetzt, mit 37, habe ich noch Schlafprobleme.“
Die Abgeordnete machte deutlich: „An intergeschlechtlichen Kindern, denen bei der Geburt nichts fehlt außer Akzeptanz, gehört nicht herumgeschnippelt und -gedoktert.“ Sie bemängelte, dass der Gesetzentwurf zu viele Hintertüren offenhalte, etwa für solche Mediziner oder Eltern, die danach suchten.
Grüne: Nur Betroffene sollten entscheiden können
Sven Lehmann von der Grünen-Fraktion kritisierte, dass viele Betroffene wenig über ihre Operationen wüssten und forderte daher ein Bundeszentralregister, „welches es den Kindern erleichtern würde, später etwas über die an ihnen vorgenommenen Operationen und Behandlungen zu erfahren“.
Zudem seien die vorgesehenen Verjährungsfristen für Gerichtsakten „deutlich zu kurz“, mahnte Lehmann. Lehmann begründete, dass seine Fraktion den Gesetzentwurf ablehnte, damit, dass „die Entscheidung über den eigenen Körper und über das eigene Geschlecht nur bei einer Person liegen kann, und zwar bei jedem Menschen selber“.
Abgelehnte Anträge
Die Fraktionen der AfD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen hatten sogenannte Entschließungsanträge eingebracht. So forderte die Fraktion der AfD zu prüfen, inwieweit ein zentrales Patientenregister für Betroffene mit Varianten der Geschlechtsentwicklung etabliert werden kann, etwa zu Forschungszwecken. Die Fraktion der FDP sowie die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen forderten eine Verschärfung des Gesetzes. Die Grünen-Fraktion möchte zudem, dass Möglichkeiten werden, mit denen Betroffene ein Schmerzensgeld einklagen können.
Die drei Entschließungsanträge wurden im Bundestag abgelehnt. Das Video der gesamten Debatte könnt ihr hier anschauen:

Daniel Heinz
... (25) arbeitet in der queeren und rassismuskritischen Bildungsarbeit, unter anderem für die Bildungsstätte Anne Frank. Ansonsten ist Daniel dafür bekannt, das beste Pfannkuchen-Rezept in Berlin zu haben.