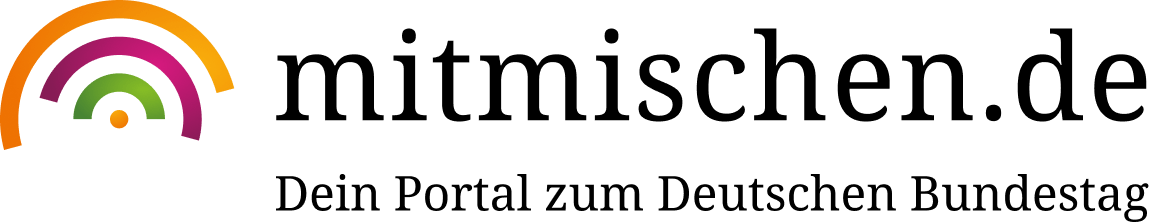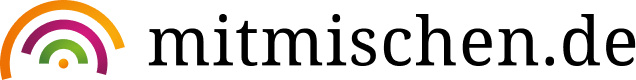Gedenkstätte „Erinnerungskultur muss sich immer wandeln“
In Ravensbrück stand das größte Frauen-Konzentrationslager. 130.000 Frauen mussten hier Zwangsarbeit leisten, viele haben das Lager nicht überlebt. Matthias Heyl ist in der heutigen Gedenkstätte für die Bildungsarbeit zuständig. Er will die Geschichte für junge Menschen zugänglich machen, ohne sie zu belehren.

„Wir wollen Jugendlichen die Chance geben, sich als Teil einer Erinnerungskultur zu begreifen“, sagt Matthias Heyl. © DBT/Stella von Saldern
Als das Lager 1939 gegründet wurde, wurden deutsche Häftlinge aus dem Vorgängerlager, dem KZ Lichtenburg, hierher deportiert. Das waren zum Beispiel Zeuginnen Jehovas, politische Häftlinge, Frauen, die wegen vermeintlicher „Rassenschande“ als Jüdinnen verfolgt wurden, Häftlinge, die als sogenannte „Arbeitsscheue“ in der Kategorie „Asoziale“ geführt wurden, und Frauen, die wegen krimineller Delikte vorbestraft waren.
Mit Beginn des Krieges kamen auch immer mehr Frauen aus den besetzen Ländern nach Ravensbrück. Auch das waren im Wesentlichen politische Häftlinge, die im Widerstand gegen die deutsche Besatzung aktiv waren. Unter den 130.000 Frauen, die im Laufe der Jahre in Ravensbrück inhaftiert waren, galten etwa 70.000 als politische Gefangene. 20.000 wurden in der Kategorie „Jüdinnen“ geführt.
Was wir über die lesbischen Frauen in Ravensbrück wissen, wissen wir hauptsächlich von Überlebenden. Allerdings nicht von lesbischen Überlebenden, da gibt es nur geringe Überlieferungen. Vielfach sind die Beschreibungen der lesbischen Frauen von Homophobie geprägt, die auch unter den Mithäftlingen gängig war. Gelegentlich werden lesbische Beziehungen als eine Art Notfall-Sexualität beschrieben. Oft wird in den Schilderungen auch nicht ganz deutlich, inwieweit Intimität und Freundschaft, die Wärme, die die Frauen versuchten, einander zu geben, wirklich als lesbische Beziehungen zu deuten sind.
Da gibt es keine gesicherte Zahl. Viele der Frauen, die lesbisch lebten, wurden nicht mit dem Haftgrund „lesbisch“ eingeliefert. Denn offiziell wurden lesbische Beziehungen nicht strafrechtlich verfolgt. Häufig wurden andere Vorwände für die Verhaftung genutzt. Es gibt nur relativ wenige Vermerke in Gestapo-Berichten und Einlieferungsdokumenten – von denen auch nur wenige erhalten sind –, wo auf eine lesbische Orientierung hingewiesen wird. Das war bei den homosexuellen Männern anders.

Die Gedenkkugel erinnert an die lesbischen Frauen, die in Ravensbrück inhaftiert waren. © DBT/Stella von Saldern
Die Häftlinge wurden früh geweckt. Dann hatten sie eine Stunde Zeit, ihre Betten herzurichten, die wenigen Waschmöglichkeiten zu nutzen und ein karges Frühstück zu essen. Danach mussten sie in den Morgenappell, wo sie sich militärisch formiert aufstellen mussten und gezählt wurden. Häufig wurden sie da schon schikaniert. Dann ging es in die streng überwachte Zwangsarbeit, in Industriebetrieben der SS vor Ort oder auch außerhalb des Lagers, in der Landarbeit oder in Betrieben. Mit einer halbstündigen Mittagspause arbeiteten sie oft zehn bis zwölf Stunden – und das sechs oder sogar sieben Tage in der Woche. Nach der Arbeit wurden sie noch einmal gezählt, bekamen eine wässrige Suppe zu essen und dann ging es in die Baracken. Die Baracken waren anfangs für 300 Häftlinge gedacht. Später waren sie aber so überfüllt, dass 800, 1.000 oder sogar mehr Häftlinge darin auf engstem Raum zusammengepfercht waren.
Das ist ausgesprochen schwierig zu erfassen. Erste Schätzungen der Alliierten gingen von 92.000 Menschen aus, die Ravensbrück nicht überlebt haben. Dabei wurden aber alle Häftlinge mitgezählt, die auf Todesmärsche geschickt oder in andere Lager überstellt wurden. Deren Schicksale sind zum Teil schwer nachzuverfolgen. Heutige Schätzungen gehen davon aus, dass etwa 30.000 Menschen Ravensbrück nicht überlebt haben. Nicht alle davon sind hier vor Ort ermordet worden, viele sind auch in Vernichtungslager wie Auschwitz überführt worden.
Ich erlebe immer wieder, wie Besucher sagen, dass es sie ergreift, an diesem Ort zu erfahren, was hier stattgefunden hat. Dass es dadurch sehr viel greifbarer wird. Die Konzentrationslager wurden zwar oft nach der Befreiung anders genutzt. Beispielsweise wurde das ehemalige Lagergelände des Konzentrationslagers Ravensbrück in großen Teilen als militärische Garnison der Roten Armee genutzt. Dadurch wurden viele historische Spuren beseitigt. Deshalb braucht es Vorstellungskraft, um zu erfassen, was hier passiert ist. Ich glaube aber, dass dieser Prozess, sich gedanklich damit zu beschäftigen, es möglich macht, einen Zugang zur Geschichte zu bekommen. Was für Ravensbrück auch von besonderer Bedeutung ist, ist dass wir hier in den letzten Jahrzehnten sehr intensiv mit Überlebenden zusammenarbeiten konnten. Wir haben ihre Geschichten gehört und versuchen, biografisch-konkret von ihren Gewalterfahrungen zu erzählen.

Es ist schwer zu ermitteln, wie viele Frauen in Ravensbrück ums Leben kamen. Schätzungen gehen von etwa 30.000 Todesopfern aus. © DBT/Stella von Saldern
Viele Jugendliche kommen hier in einem schulischen Kontext her, also nicht ganz freiwillig. Wir wollen ein außerschulischer Lernort sein, an dem nicht zensiert wird, was die Jugendlichen von hier mitnehmen. Ich nehme wahr, dass viele der Jugendlichen trotz des zeitlichen Abstands der Geschehnisse mit einem großen Interesse kommen. Manche sind aus Familien, die nach dem Krieg nach Deutschland migriert sind, aber auch die haben oft anknüpfungsfähige Erfahrungen. Zum Beispiel haben Geflüchtete aus Syrien oder der Ukraine eigene Kriegs- und Fluchterfahrungen.
Wir haben das große Glück, dass wir hier auch eine internationale Begegnungsstätte haben, wo Gruppen länger bleiben können. Bei diesen längeren Aufenthalten versuchen wir, den Jugendlichen den Raum zu geben, ihre eigenen Gefühle und Gedanken mit einzubringen. Ein Leuchtturmprojekt ist zum Beispiel „Sound in the Silence“. Dafür arbeiten wir mit internationalen Künstlerinnen und Künstlern zusammen, die eine Rap-Performance entwickeln, bei der die Jugendlichen sich tänzerisch ausdrücken können. In den vergangenen Jahren konnten wir das auch mit Überlebenden gestalten. Die waren erst zögerlich, denn für eine 98-Jährige ist Rap natürlich nicht das Erste, woran sie denkt, wenn sie über künstlerische Formen in Ravensbrück nachdenkt. Aber auch die Überlebenden haben uns letztlich gespiegelt, dass es für sie von besonderer Bedeutung war, mit Formen zu arbeiten, die den Jugendlichen Ausdrucksmöglichkeiten geben.
Oder wir lassen die Jugendlichen ein Thema auswählen, für das sie sich besonders interessieren. Dazu recherchieren sie dann und machen einen Podcast, in den sie auch ihre eigene Wahrnehmung einbringen können. So haben sie die Chance, sich als Teil einer Erinnerungskultur zu begreifen.
Erinnerungskultur muss sich immer wandeln. Sie wird in jeder Generation neuen Ansprüchen genügen müssen. Ich glaube, wenn wir heute und morgen Jugendliche erreichen wollen mit Gedenkstättenarbeit, dann müssen wir im Blick haben, welche Erwartungen sie mit einbringen.
Unsere Aufgabe ist es, mit den Jugendlichen gemeinsam im Bildungsprozess Formen zu entwickeln, die es ihnen ermöglichen, Zugang zur Geschichte zu finden. So wird Erinnerungskultur lebendig und spannend, wenn die Jugendlichen sich nicht nur als Belehrte begreifen, sondern verstehen, dass es für sie einen Zugewinn bedeutet, sich mit der Geschichte zu beschäftigen. Denn wer Bescheid weiß über diese Geschichte, der ist auch in der Lage, Entwicklungen zu erkennen, die für eine Gesellschaft riskant werden können.
Matthias Heyl
Matthias Heyl hat Geschichte, Psychologie und Erziehungswissenschaft studiert. Er leitete die Forschungsstelle „Erziehung nach/über Auschwitz“, bevor er 2002 zur Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück kam, wo er die Pädagogischen Dienste und die Internationale Jugendbegegnungsstätte leitet.