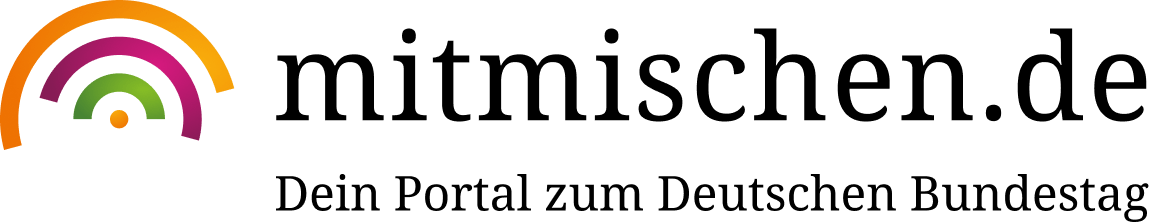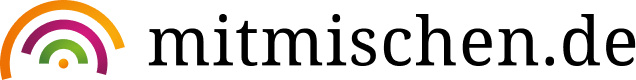Fischfang Von Aalen und Schweinehunden: An Bord mit Fischer Jensen
Olaf Jensen ist einer der letzten Elbfischer. Bei jedem Wetter steuert der 63-Jährige sein Boot durch den Hamburger Hafen. Immer auf der Suche nach dem großen Fang. mitmischen-Autorin Irina hat ihn morgens um 4 Uhr getroffen und auch erfahren, welche Gefahren in der Tiefe lauern.

Elbfischer Olaf Jensen ist einer der letzten Fischer auf der Elbe. © picture alliance / blickwinkel/C. Kaiser | C. Kaiser
Ein weißer Caddy fährt vor, wendet und bleibt im Schein einer Laterne am Straßenrand stehen. Die Fahrertür stößt auf. Ein hagerer Mann mit Latzhose und Schiebermütze steigt aus, über dem blauweißgestreiften Fischerhemd trägt er eine dunkle Strickjacke, einige Nummern zu groß. Er stapft zum Anhänger, zieht zwei Benzinkanister hervor, hievt sie auf eine Sackkarre und verschwindet auf einem Metallsteg, der zwischen dichtem Gestrüpp am Wegesrand zum Wasser führt. 4 Uhr. Arbeitsbeginn.
Olaf Jensen, 63, ist Fischer. Einer der letzten Fischer auf der Elbe. Unten am Steendiekkanal in Hamburg-Finkenwerder liegt sein Boot, „Käptn‘ Butt“, wie er es nennt. Gerade trifft er die letzten Vorbereitungen vor dem Ablegen. Polternd zieht er die Karre durch die Nacht. Möwen kreischen. In der Ferne heulen Sirenen. „Die Berufsfischer auf der Elbe kannst du an zwei Händen abzählen“, sagt Jensen und rattert die Namen runter.
Ein Leben mit der Natur
Er selbst verdient sein Geld seit rund 40 Jahren mit dem Fangen von Aal, Zander, Wollhandkrabben und Stint. Ab und an ist er auf der Ostsee unterwegs, dann kommen Hering und Scholle dazu. Einst finanzierte sich Jensen so sein Studium der Politikwissenschaft.
Die Fischerei aber begleite ihn schon viel länger, erzählt der hoch aufgeschossene Mann mit den strahlend blauen Augen und den buschigen weißen Brauen. Er geht mit schweren Schritten über den Steg und wirft zwei Reusen auf das angeleinte Boot. Seinen ersten Fisch, einen Dorsch, habe er mit fünf oder sechs Jahren im Sommerhaus der Eltern in Dänemark gefangen.
Später entscheidet sich Jensen gegen ein Dasein als Akademiker und für die Fischerei. Für ein Leben mit harter körperlicher Arbeit, mit wechselnden Arbeitszeiten und jeder Menge Überstunden. Aber auch: Für ein Leben mit der Natur. Fischfang sei mehr als ein Beruf, sagt Jensen, der sich seit Jahren im „Förderverein für die Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume“ engagiert. „Sich auf die verschiedenen Fischarten einlassen. Überlegen, wo sich die Tiere aufhalten“, so beschreibt er dieses „mehr“.
Vorsorgen für schlechte Zeiten
Die Elbe glitzert an diesem Morgen in den Nachtlichtern der Stadt. Kaum eine Welle. Das habe „schon ein bisschen was Idyllisches“, sagt Jensen. Aber es gebe auch anderes Wetter. Wer Fischer oder Fischerin werden wolle, müsse „einen gewissen Biss haben“. Und vor allem müsse man leben wie ein Eichhörnchen und vorsorgen für schlechte Zeiten. „Denn die kommen auf jeden Fall.“
Jensen steigt auf das Boot. „Käpt’n Butt“ schaukelt. Mit schnellen Handgriffen sortiert er die Netze und verstaut sein Proviant, drei Äpfel, in einem Eimer. Die nächsten sechs Stunden wird Jensen auf der Elbe unterwegs sein und seine Fanggründe abfahren. Acht Stationen hat er vor sich. Sein Revier reicht von Wedel an der Unterelbe bis Oortkaten an der Oberelbe. Bevor er aufbricht, tauscht er die Arbeitsschuhe gegen Gummistiefel und schlüpft in sein orangefarbenes Ölzeug. Er macht die Leine los, wirft den Motor an und steuert in Richtung Hafen.

Olaf Jensen ist auf der Elbe in Hamburg unterwegs. Im Hintergrund sieht man die Krähne des großen Industriehafens. © picture alliance / blickwinkel/C. Kaiser | C. Kaiser
Den Schweinehund überwinden
Bevor Jensen die erste Boje anfährt, seine Reusen hochzieht und die gefangenen Aale in einen Eimer schüttet, muss er die Reporterin am Ufer absetzen. Zu gefährlich, erklärt der Fischer. Jensen selbst landete schon zweimal im unruhigen viel befahrenen Gewässer. Mit letzter Kraft rettete er sich ans Ufer. Wegen der Elbvertiefung gebe es unterschiedliche Strömungsgeschwindigkeiten. Zum Teil liege die Strömung bei bis zu vier Knoten, umgerechnet etwa acht Stundenkilometer. „Wenn man da reinfällt, kommt man nicht gegen an.“
Als Tidengewässer verändert sich der Wasserstand der Elbe regelmäßig: Mit der Flut steigt er innerhalb weniger Stunden auf den Höchstwasserstand. In den darauffolgenden etwa sieben Stunden sinkt er wieder ab. In dieser Zeit ist der 63-Jährige unterwegs. Mal um drei Uhr nachts, mal um drei Uhr nachmittags. „Als Selbständiger kontrolliert dich keiner“, sagt er. „Da muss man schon öfter mal seinen inneren Schweinehund überwinden.“
Mehr Vorschriften, weniger Fang
Sein Fang wird an diesem Morgen „ganz ordentlich“ sein, wie er später berichtet. Doch damit ist die Arbeit nicht getan. Wer heutzutage von der Fischerei leben wolle, so Jensen, müsse nach der Lehre zum Fischwirt eigentlich noch ein Jurastudium dranhängen und ein BWL-Studium obendrauf packen. Schließlich müsse man den Fisch selber vermarkten, es gebe viel mehr Vorschriften und „Zettelwirtschaft“ als früher.
Gleichzeitig geht auf der Elbe der Fang zurück. „Noch vor ein paar Jahren“, erzählt der Hanseat, „hätte ich gesagt, die Zukunft sieht so schlecht nicht aus“. Heute würde er das nicht mehr unterschreiben. Seine Söhne, 27 und 30, haben denn auch andere Berufe gewählt. 640 Euro Rente im Monat werden Jensen bleiben. Trotzdem hat er seine Entscheidung nie bereut.
Frisch aus dem Räucherofen
Unter der Woche landet sein Fang in den Küchen verschiedener Restaurants. Samstags hingegen steht Jensen in seiner selbstgebauten Räucherhütte in Finkenwerder, wo er die Fische in einem traditionellen Ofen über offenem Feuer räuchert und direkt vor Ort verkauft.
„Der Fisch ist vielleicht nicht so schön wie der aus einem elektrischen Ofen, aber dafür haltbarer und schmackhafter“, sagt Jensen. Eine dichte Rauchwolke quillt in die Hütte, als er die Ofentür öffnet und einen Blick auf die aufgespießten Aale wirft. „Es braucht eine gewisse Temperatur“, erklärt er und schüttet einen Eimer Wasser auf das Feuer. Luftfeuchtigkeit, Außentemperatur, Wind. Das alles muss Jensen im Blick haben.
„Moin, dauert noch!“
11.45 Uhr. Die Fische sind mittlerweile seit gut zwei Stunden im Ofen und können abkühlen. Bis zum Verkauf dauert es zwar nochmal fast genauso lang, trotzdem stehen schon die ersten Kunden bereit: Ein Ehepaar, Mitte 50, sportlich gekleidet. „Moin, dauert noch!“, ruft er den beiden zu und zeigt auf einige Plastikstühle.
Eine Stunde später, Jensen hat schon die Auslage seines weißen Verkaufswagens vorbereitet und sich die Lesebrille zurechtgelegt, reicht die Schlange über den gesamten Platz. Ältere Männer in Jeans und Karohemden warten neben einem Paar im Segleroutfit. Man spricht über das Wetter, über Fußball und darüber, wer schon einmal leer ausging und keinen Aal vom Olaf mehr bekam.
„Ein Ehepaar kommt alle zwei Wochen aus Hannover“, erzählt der Fischer und beißt in einen Apfel. „Wir sind aus Bremen“, ruft die Frau vom Paar im Segleroutfit. Jensen, der den Apfel bis zum Stiel gegessen hat, läuft zurück in die Räucherhütte. Stange um Stange zieht er aus dem Ofen und lässt die Aale in große Plastikkisten gleiten. Behutsam stapelt er die Fische in der Auslage seines Wagens. Dann greift er nach Lesebrille und Maske. Bewegung kommt in die Menge. 13.30 Uhr. Der Verkauf beginnt.