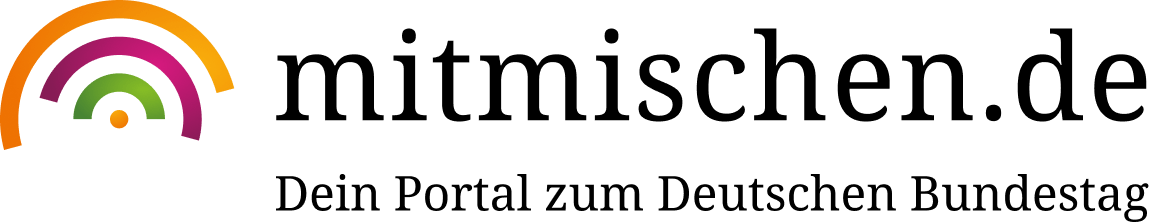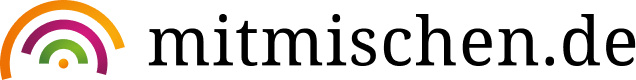18. März 1990 Die erste freie Volkskammerwahl in der DDR
Jasmin Nimmrich
Demokratische Wahlen gab es in der DDR nicht. Erst am 18. März 1990, der Wahl zur 10. Volkskammer, hatten die Bürgerinnen und Bürger wirklich eine Wahl. Und was sie auf der Straße mit der Friedlichen Revolution begonnen hatten, wurde durch das zehnte und letzte Parlament der DDR zu Ende geführt: Die Wiedervereinigung mit der Bundesrepublik Deutschland.

Auf einer Montagsdemonstrationen in Leipzig am 29. Januar 1990 begrüßen die Demonstranten die angekündigte Volkskammerwahl am 18. März. © picture alliance / Wolfgang Weihs
Seit der Gründung der DDR glichen die Wahlen in dem Land einer Inszenierung. Den Wählerinnen und Wählern wurden sogenannte Einheitslisten präsentiert, auf denen vorgefertigte Wahlvorschläge zu finden waren, denen man zustimmen konnte – eine aktive Ablehnung war nur theoretisch möglich. Durch die Vorformulierung der Wahllisten stellte die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED), die die DDR seit 1949 regierte, ihre Macht sicher. Das Ergebnis der Wahl stand also schon fest, bevor die Wahllokale überhaupt geöffnet wurden.
Mit dem Sommer 1989 und dem Beginn der Friedlichen Revolution, die nach einem gesellschaftspolitischen Wandel in der DDR strebte, wurden die Forderungen nach demokratischen Wahlen jedoch lauter. Grund für das politische Aufbegehren der DDR-Bürgerinnen und Bürger waren unter anderm die sich drastisch verschlechternde wirtschaftliche Situation der DDR sowie ausbleibende politische Reformen. Auf den sogenannten Montagsdemonstrationen forderte das Volk im Sommer und Herbst 1989 Reise-, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit für alle. Begleitet wurden diese Proteste außerdem durch massive Ausreise- und Flüchtlingswellen aus der DDR. Um diese zu beenden, verkündete das SED-Regime auf einer improvisierten Pressekonferenz am 9. November 1989 Reiseerleichterungen für alle DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Die ersten Meldungen zu der sofortigen Maßnahme gelangten gegen 19 Uhr an die Öffentlichkeit, zu Tausenden strömten die Bürgerinnen und Bürger an die Grenzübergänge.
Um die DDR nach dem Mauerfall in die Zukunft zu navigieren, fand sich am 7. Dezember 1989 erstmals der Runde Tisch, bestehend aus Vertretern der DDR-Regierung, von SED-Massenorganisationen, der Blockparteien sowie der Opposition und der Kirchen, zusammen. Bereits in der ersten Sitzung des Gremiums wurde beschlossen, die ersten freien Volkskammerwahlen abzuhalten. Zunächst war der Plan, dass am 6. Mai 1990 gewählt werden sollte. Doch aufgrund der angespannten wirtschaftlichen und politischen Lage sowie der Notwendigkeit einer handlungsfähigen Regierung beschloss der Runde Tisch die Wahlen der 10. Volkskammer um sechs Wochen, auf den 18. März 1990, vorzuziehen.

Die Volkskammer der DDR tagte zwei bis vier Mal pro Jahr im Palast der Republik in Ost-Berlin. Heute steht an dieser Stelle das Humboldt-Forum, bei dem Teile der historischen Fassade erhalten wurden. © IMAGO / Sven Simon
Demokratie kann überraschen
Auf den Wahlzetteln standen am 18. März 1990 dann 24 Parteien und Vereinigungen. Mit der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr hatten 93,4 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.
Wahlsieger war mit 48,1 Prozent der Stimmen die konservative „Allianz für Deutschland" . In diesem Bündnis fanden sich drei Parteien zusammen: die ostdeutsche CDU, der Demokratische Aufbruch (DA) und die Deutsche Soziale Union (DSU). Der konservative Zusammenschluss trat mit der Unterstützung der westdeutschen CDU/CSU im Wahlkampf für eine schnelle Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten ein und warb mit dem Wahlspruch „Freiheit und Wohlstand – Nie wieder Sozialismus” für sich.
Die SPD wurde mit 21,9 Prozent die zweitstärkste Fraktion. Vorangegangene Umfragen hatten sie als Wahlsiegerin prognostiziert – ein möglicher Fehler der Umfragen: sie wurden via Telefon durchgeführt, in der DDR hatten jedoch weniger als zehn Prozent der Privathaushalte einen Telefonanschluss. Die Staatspartei selbst, die sich zuvor in die Partei des demokratischen Sozialismus (PDS) umbenannt hatte, erhielt 16,4 Prozent der Wählerstimmen. 5,3 Prozent der Wählerstimmen konnte der „Bund Freier Demokratien” verbuchen, der im Wahlkampf politische Unterstützung von der westdeutschen FDP erhielt.
Die 10. DDR-Volkskammer
Von der ersten Sitzung der 10. Volkskammer am 5. April 1990 bis zur Wiedervereinigung von BRD und DDR vergingen sechs Monate. Innerhalb dieser Amtszeit traf sich das letzte DDR-Parlament genau 38 Mal und verabschiedete mehr als 140 Gesetze, um dem Willen der Wählerinnen und Wähler gerecht zu werden, die DDR in ein wiedervereinigtes Deutschland zu führen.

Stehend und applaudierend begrüßen die Abgeordneten der Volkskammer am 23. August 1990 um drei Uhr morgens den Beschluss über den Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland zum 3. Oktober 1990 © picture-alliance/ dpa | Michael Jung
Am 23. August 1990 verabschiedeten die 400 Abgeordneten mit dem „Vertrag über die Herstellung der Einheit Deutschlands” den vielleicht wichtigsten Beschluss der DDR-Geschichte: Die fünf Bundesländer der DDR sollten nach Artikel 23 des Grundgesetzes am 3. Oktober 1990 der Bundesrepublik Deutschland beitreten.