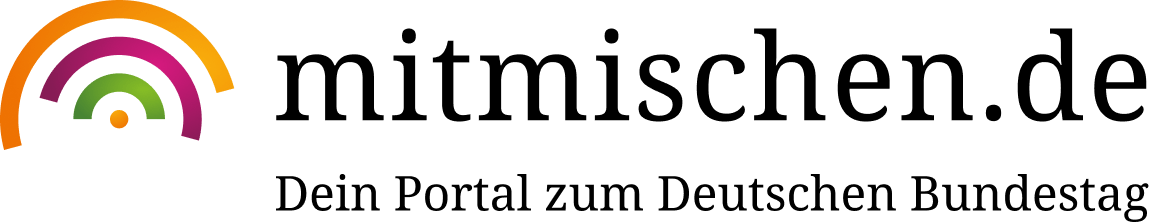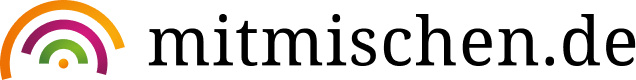Expertin für politische Bildung „Junge Menschen müssen mitbestimmen“
Gymnasiasten bekommen eine deutlich bessere politische Bildung als Schüler anderer Schulformen. Das hat die Wissenschaftlerin Sabine Achour herausgefunden. Uns hat sie erklärt, wie man alle Jugendlichen erreichen könnte.

„Mitbestimmen in der Schule und im Unterricht, Mitwirken an einer Schülerzeitung“ – diese Dinge seien für politische Bildung essenziell, sagt die Wissenschaftlerin Sabine Achour. © Fotostudio Charlottenburg
Die politische Bildung spielt seit einigen Jahren wieder eine größere Rolle an deutschen Schulen. In letzter Zeit beobachte ich eine Stärkung des Fachs, gerade in Bundesländern wie Sachsen oder Berlin.
Das hat sicherlich auch etwas mit gesellschaftlichen Entwicklungen zu tun. Zum Beispiel lässt sich zunehmend Rechtspopulismus beobachten, es gibt vermehrt migrationsskeptische Diskurse, die auch in Richtung Verschwörungsglauben gehen. Die Aufmerksamkeit für politische Bildung ist – leider erst – in solchen Zeiten größer. Aber wir wissen, dass Schule die Institution ist, durch die wir alle Jugendlichen erreichen können.
In der Summe aller Erkenntnisse würde ich sagen, dass sich das als Trend erkennen lässt. Aber es gibt nicht die eine Studie, auf die ich mich hier beziehen kann. Denn für so eine Studie müsste man den gesamten Lebenslauf der Teilnehmenden erfassen, und das ist schwierig.
In unserer Studie haben wir aber beispielsweise festgestellt, dass diejenigen, die viel politische Bildung erfahren, menschenfeindliche und demokratiefeindliche Einstellungen stärker ablehnen. Diese Jugendlichen waren auch eher bereit, politisch zu partizipieren. Außerdem konnten wir feststellen, dass bei diesen Teilnehmenden das Vertrauen in Demokratie und politische Institutionen höher war. Das sind Hinweise darauf, dass die Angebote der politischen Bildung wirken können.
Politikunterricht ist sehr wichtig, aber es geht meiner Meinung nach gar nicht nur darum, zwei Stunden pro Woche Politik zu unterrichten. Wichtig ist es auch, dass sich alle Lehrkräfte in gesellschaftlich oder schulisch herausfordernden Situationen dafür zuständig fühlen, mit den Kindern und Jugendlichen über die Ängste und Sorgen zu sprechen und Hintergrundwissen zu vermitteln. Ich denke dabei zum Beispiel an den Ukraine-Krieg.
Darüber hinaus sind Dinge wie das Mitbestimmen in Schule und Unterricht, das Mitwirken an einer Schülerzeitung oder politischen Projekten essenziell: Je mehr Angebote zusammenkommen und je mehr man selbst demokratische Erfahrungen und demokratisches Miteinander erleben kann, desto besser.
Außerdem sollte eine demokratische Schule Lernende mitentscheiden lassen, wenn es um die Auswahl von Themen oder Methoden geht. Demokratische Prinzipien in ganz unterschiedlichen Dimensionen des Alltags miterleben zu können, ist für die junge Menschen besonders relevant. Zu meinen Studierenden sage ich immer: Man kann nicht Demokratie unterrichten und jungen Menschen mitgeben wollen, dass Grundrechte und Minderheitenschutz wichtig sind, und selber einen eher autoritären Unterrichtsstil verfolgen. Das heißt, wenn wir über politische Bildung an Schulen sprechen, reicht es nicht, die Kinder und Jugendlichen in den Blick zu nehmen, sondern es sollte auch um die Lehrkräfte gehen.
Der Konsens besagt vor allem, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen müssen, in einer Gesellschaft, die von Kontroversen und Konflikten geprägt ist, eigene Positionen zu entwickeln. Um das möglich zu machen, sind Lehrkräfte und Schulen angehalten, diese politischen und gesellschaftlichen Kontroversen so widerzuspiegeln, wie sie in der Realität existieren. Das heißt: Alles, was in der Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen, und die Jugendlichen dürfen nicht in eine Richtung beeinflusst werden.
Ebenso relevant ist es aber auch, die Grenzen der Kontroversität in einer offenen Gesellschaft abzustecken. Nicht alles fällt unter die Meinungsfreiheit. Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, antidemokratische Positionen oder Feindlichkeit gegen sexuelle Vielfalt müssen klar als Grund- und Menschenrechtsverletzungen markiert werden. Auch das verlangt der „Beutelsbacher Konsens“. Er ist eben wie auch die politische Bildung nicht wertneutral und beinhaltet auch kein Neutralitätsgebot.
Dass der Konsens nun so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, hängt auch mit den Meldeplattformen der AfD zusammen: Die AfD versucht den Konsens für ihre Zwecke zu missbrauchen, indem sie in einigen Bundesländern dazu aufgerufen hat, Lehrkräfte zu melden, die sich vermeintlich nicht neutral verhalten.„Beutelsbacher Konsens“
Der Beutelsbacher Konsens
Im sogenannten Beutelsbacher Konsens wurden in den 1970er Jahren Grundsätze für die politische Bildung formuliert. Der Konsens ist das Ergebnis einer Tagung der Baden-Württembergischen Landeszentrale für politische Bildung im schwäbischen Beutelsbach. Er legt drei Prinzipien für den Politikunterricht fest.
Das Überwältigungsverbot: Lehrkräfte dürfen den Schülern ihre Meinung nicht aufzwingen.
Kontroversität: Ein Thema muss von der Lehrkraft kontrovers dargestellt und diskutiert werden, wenn es kontrovers erscheint.
Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, die politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren sowie nach Mitteln zu suchen, die politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen.
Politische Sozialisation findet in vielen Bereichen statt: in den Familien, in der Schule, im Freundeskreis, in Social Media, in den klassischen Medien, im Sportverein. Politische Bildung und Sozialisation finden also auch außerhalb von Schule statt. Die Familie ist für die Politisierung wichtig und spielt eine Rolle. Benachteiligt sind allerdings Kinder und Jugendliche aus sozio-kulturell weniger privilegierten Familien: wenn Politik zu Hause etwa kaum Thema ist und auch die Schule wenig auffangen kann – aufgrund fehlender Angebote oder geringer Qualität.
Das Prinzip „Wer hat, dem wird gegeben“ verweist auf die Ergebnisse der Studie: Kinder und Jugendliche aus privilegierten Elternhäusern, in denen Politik häufiger thematisiert wird, erfahren auch an den Schulen oft mehr und bessere politische Bildung. Ein zentraler Grund dafür ist, dass diese Kinder und Jugendlichen auch häufiger das Gymnasium besuchen. Dort ist die politische Bildung nach unseren Ergebnissen besser aufgestellt.
Umgekehrt besuchen Jugendliche aus weniger privilegierten Elternhäusern, deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben und bei denen keine Bücherwände zu Hause stehen, seltener das Gymnasium. An den nichtgymnasialen Schulformen ist die politische Bildung allerdings weniger gut aufgestellt und wird zum Beispiel auch oft fachfremd unterrichtet.
Konkret heißt das, die einen diskutieren abends auch mal mit den Eltern über den Koalitionsvertag oder über Fridays for Future und haben Zugang zu mehr Angeboten politischer Bildung am Gymnasium. Sie gehen auf Exkursionen oder debattieren mit Politikerinnen oder Politikern.
An anderen Schulformen ist das nicht der Fall. Das lässt sich besonders in den höheren Klassen beobachten: Wer bis zum Abitur in der Oberstufe verweilt, hat sehr viel umfassendere Zugänge zur politischen Bildung als diejenigen, die in die berufliche Bildung gehen, also eine Ausbildung machen. Sie bekommen selten ein annähernd so gutes Angebot.
Wir haben mittlerweile ein umfassendes außerschulisches Angebot in Deutschland. Ich sehe aber auch die Notwendigkeit, langfristige und nachhaltige Angebote zu schaffen. Wir brauchen Angebote, bei denen Kinder und Jugendliche selbst entscheiden können, wie politische Bildung für sie aussieht, wie sie gestaltet sein soll und welche Ziele sie damit erreichen möchten.
Für die Förderung von Urteils- und Handlungsfähigkeit ist es entscheidend, dass Angebote motivierend, lebensnah und interessensgeleitet gestaltet sind. Man sollte zum Beispiel auch Sportvereine oder Jugendclubs, die sich auf verschiedene Arten mit politischer Bildung beschäftigen, stärken. Auch hier eröffnen sich Zugänge zu Kindern und Jugendlichen, die von allein nicht unbedingt zu einer Veranstaltung gehen, auf der „politische Bildung“ draufsteht.
Sabine Achour ist 1973 in Berlin geboren. Nach der Schule studierte sie Politikwissenschaft und Latein. Seit 2018 ist sie Professorin für Politikdidaktik und Politische Bildung an der Freien Universität Berlin, zuvor war sie als Professorin in Marburg tätig. In ihrer Forschung beschäftigt sich Achour mit Aspekten wie Flucht und Migration, Inklusion und religiöser Vielfalt – und mit der Frage, wie politische Bildung auf diese Themen reagieren kann.
(Julia Karnahl)