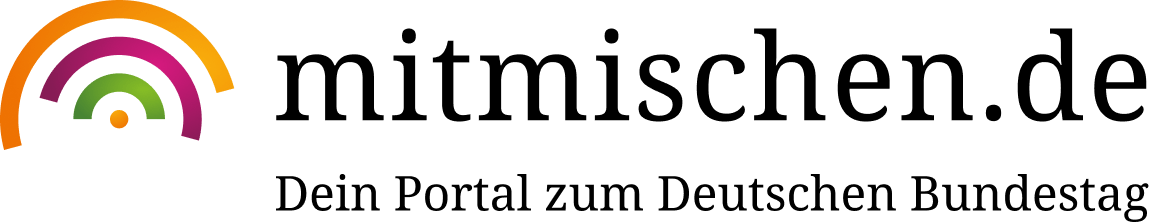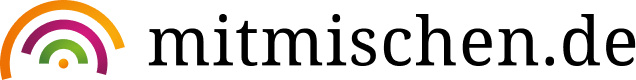PPP-Stipendiaten in den USA Liska, 16, von Schleswig-Holstein nach Seattle
Ein ganzes Jahr voller Abenteuer, neuer Freundschaften und unerwarteter Herausforderungen: Begleite Liska auf ihrer Reise durch das aufregende Leben in Seattle, der Stadt zwischen Bergen und Meer!

Liska verbringt ihr PPP-Auslandsjahr in Seattle im Staat Washington an der Westküste der USA. © privat
Hey!
Ich bin Liska, stamme ursprünglich aus dem schönen Norden Deutschlands, aus der Nähe von Hamburg, und darf dieses Jahr Dank des Parlamentarischen Patenschafts-Programms in den Vereinigten Staaten verbringen.
In meiner Freizeit beschäftige ich mich viel mit Kunst, zeichne, schreibe oder drehe eigene Filme. Wenn ich mich nicht gerade mit Freunden für einen Spieleabend oder einen Filmmarathon treffe, verbringe ich meine Zeit gerne im Tanzstudio, wo ich mehrmals die Woche Standardtanzunterricht nehme. Für ein Auslandsjahr habe ich mich vor allem beworben, um zu reisen und neue Kulturen und Menschen kennenzulernen. Das Wahljahr war ein großer Faktor, weshalb ich mich genau dieses Jahr dazu entschieden habe. Es ist eine unheimlich einzigartige Stimmung, politisch und menschlich, die es in Deutschland so nicht gibt.
Meine Reise geht nach Seattle, wo ich Mitte September gelandet bin. Die Gastfamiliensuche war schon ein Abenteuer. Mein Weg hat mich aber letztendlich zu einem Single-Parent-Placement geführt. Ich lebe allein mit meiner Hostmom, direkt in Seattle, zehn Minuten von der Space Needle – ein sehr hoher Aussichtsturm und Wahrzeichen der Stadt – entfernt, während mein Gastbruder zurzeit in Kalifornien studiert. Ich hatte viel Respekt vor den Herausforderungen des Auslandsjahres und bin sehr froh, dass ich schon viele und sehr liebe Freunde gefunden habe und mich bereits richtig heimisch in Seattle fühle.
Seattle Kunterbunt
Was mir als erstes eingefallen ist, als ich mein Placement bekam, also erfuhr, dass ich in Seattle leben werde, war das eher trübe Wetter und das bekannte Wahrzeichen – die Space Needle. Vielleicht sogar das eher konservative Stereotyp eines Amerikaners aus Filmen. Doch für mich hat sich alles gedreht, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Wie Seattle so richtig tickt, davon hatte ich vor gut einem Monat noch gar keine Ahnung – wie die Menschen miteinander umgehen, und was die generelle Stimmung ist.
Ich besuche eine der öffentlichen Schulen in Seattle, die Franklin High School. Ein altes, steinernes Gebäude, das eher an den 90er-Jahre-Film „10 Things I Hate About You“ erinnert und dir einen atemberaubenden Blick über die Seattle-Skyline bietet. Betritt man das Gebäude, springen dir nicht nur die Schulfarben dunkelgrün und schwarz sofort ins Auge, sondern auch unzähligen Pride Flags, so wie die Trans-Flagge, die direkt vor dem Eingang zur Cafeteria den Gang schmückt. Wer Diversität schätzt und zelebriert, ist in der Franklin High School genau am richtigen Ort gelandet. In jedem Raum hängen Pride Flags, motivierende Sprüche oder kleine Zitate. Da Franklin eine Schule ist, die eine große Community an afroamerikanischen und asiatischen Schülern hat, befindet man sich schnell in einer Art „Melting Pot“ (Schmelztiegel) von verschiedenen Kulturen und Menschen, mit denen man seine eigenen Erfahrungen teilen kann. In Seattle gehen Menschen ganz offen mit dem um, wie und was sie sind. Ob Herkunft, Sexualität oder Geschlecht – irgendwie wird es offensichtlich, dass wirklich jede Person hier respektiert und akzeptiert wird, so wie sie ist.

Die Skyline von Seattle – allerdings ohne den berühmten Aussichtsturm, die Space Needle. © privat
Unterricht mal anders
Etwas, das mir geholfen hat, mich schnell wie zuhause zu fühlen, waren die Klassenräume, für deren Gestaltung die Lehrerinnen und Lehrer verantwortlich sind. Diese sind so ausgeschmückt, als würdest du das persönliche Wohnzimmer, den eigenen Gedankenraum, eines Menschen betreten. Nehme man da einmal meinen Literatur-Lehrer: Marvel- und DC-Poster, Filmplakate und gephotoshoppte Bilder von sich selbst als Superman zieren den Raum, genauso wie ein eigener Ständer an Vintage Comics, die dem Raum Leben einhauchen. In diesem Kurs wurde mir der amerikanische Unterrichtsstil zum ersten Mal nähergebracht. An der Franklin High School umfasst ein Schultag insgesamt sechs Unterrichtseinheiten je 55 Minuten. Und dieser Stundenplan wiederholt sich JEDEN Tag. Was erst einmal nach purer Langeweile klingt, wird von den Lehrerinnen und Lehrern als kreative Möglichkeit für Langzeitprojekte gut genutzt.
Und da wäre auch mein Mathekurs, AP Statistic. Während ich in Deutschland dicke Mathebücher mit langen Textaufgaben gewälzt habe, knote ich nun Gummibänder an Barbiepuppen, um sie aus einer gewissen Höhe einen Bungeejump vollziehen zu lassen. Oder mein Literaturkurs: Während ich es nur gewohnt war, klassische Gedichte auswendig zu lernen, drückt mir mein Lehrer hier Drumsticks in die Hand und motiviert uns dazu, „We Will Rock You“ zu spielen, um den Rhythmus ins Blut zu bekommen. In meinem Geschichtskurs werden bunt verzierte Kuchen gebacken und in meinem Forensikkurs lernen wir, wie man Spuren wie Blut von einem Tatort richtig einsammelt und verpackt. Für wen das jedoch zu makaber ist, gibt es auch das Fach Costume Design, in dem man zum Beispiel seinem Lieblingsfilmcharakter ein neues Outfit designen darf. Meine Schultage sind also von Teamarbeit und gemeinsamen Projekten bestimmt. Für mich hat es den Anschein, als wäre der größte Ansporn des US-amerikanischen Schulsystems, junge Menschen für das eigentliche Fach wirklich zu begeistern, beinahe mitzureißen, was auch häufig funktioniert.

Die gelben amerikanischen Schulbusse haben die meisten schon mal in Filmen gesehen – dass man Barbiepuppen im Matheunterricht Bungeejumping machen lässt, wahrscheinlich eher nicht. © privat
Auch der Umgang der Jugendlichen untereinander hat potentiellem Heimweh vorgebeugt. Einen großen Teil trägt sicherlich das amerikanische Schulkonzept dazu bei, da es etwas entspannter und mehr auf den Spaß am Lernen als auf den Lernprozess an sich ausgerichtet ist. Besonders wichtig sind hier Clubs und außerschulische Aktivitäten. Von ausgefallenen Sportarten wie Frisbee über den Roboter Club bis hin zum Fashion Club gibt es hier etwas für die Interessen jedes einzelnen Schülers. Und all das hilft wirklich immens, um sich schnell heimisch zu fühlen. Die meisten meiner Freunde habe ich im Theater Club kennengelernt – ein Club, bei dem ich mehr Muffins gegessen, als eigentliche Skripts gelesen habe.
Etwas anderes, was man sich bei mir Zuhause überhaupt nicht vorstellen könnte: jeden Tag bis 18 Uhr in der Schule zu bleiben. Hier: vollkommene Normalität. Man wächst dadurch viel mehr als eine kleine Familie zusammen und ich bin sehr, sehr froh, dass ich durch den lebendigen Unterricht und meine Clubs schnell nette Menschen kennengelernt und Freundschaft geschlossen habe.
Bis zum nächsten Mal :)