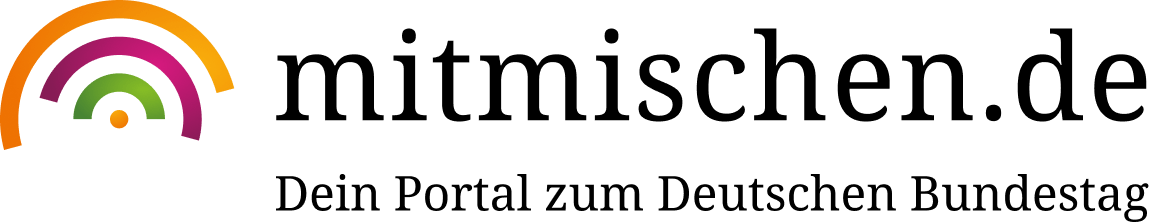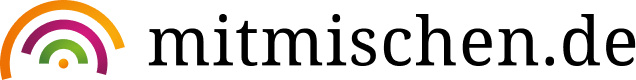Arzt aus Syrien „Man muss schon Glück haben“
Der syrische Arzt Abed Sarraf (30) arbeitet in der Uniklinik Dresden. Wie seine Anerkennung lief, was er an seinem Beruf liebt und was ihn am hiesigen Gesundheitssystem verblüfft.

Auch wenn manche deutschen Kollegen meckern – Abed Sarraf findet die Arbeitsbedingungen in Deutschland gut. "Ärzte können sich zum Beispiel Zeit für die Kindererziehung nehmen", sagt er. © privat
Wie lief Ihre medizinische Ausbildung in Syrien ab? War das vergleichbar mit einem deutschen Medizin-Studium?
Der Aufbau des Studiums orientiert sich in Syrien am französischen System. Das funktioniert ziemlich ähnlich wie in Deutschland: Man lernt drei Jahre lang die Basics. Dann kommen drei Jahre klinische Ausbildung. Und das letzte Jahr arbeitet man im Krankenhaus. Hier heißt das PJ, praktisches Jahr.
Warum haben Sie sich dafür entschieden, nach Deutschland zu kommen?
2009 war ich zu Besuch in Deutschland. Ich fand das Land schön, vor allem hat mir die gesamte europäische Kultur gefallen. Die andere Variante wäre gewesen, nach dem Studium in die USA zu gehen, dort habe ich viele Verwandte. Aber erstens fand ich eben die Kultur in Deutschland interessanter. Zweitens wollte ich nicht so weit weg sein von zuhause. Vor dem Krieg konnte man ja in drei Stunden von Frankfurt nach Aleppo fliegen. Und drittens dachte ich während des Studiums noch, dass ich Chirurg werden will – und das ist in den USA als ausländischer Medizin-Student fast unmöglich.
Warum haben Sie sich dann doch für die Innere Medizin entschieden?
Ich habe während des PJs meine Pläne geändert – da war ich schon in Deutschland. Fachlich finde ich die Chirurgie immer noch interessant. Aber dort hängt es besonders stark von einzelnen Personen und Kontakten ab, ob man wirklich reinkommt oder ob man jahrelang nur arbeitet wie eine Maschine, ohne Verantwortung übernehmen zu können. Die Weiterbildung ist nicht standardisiert, zumindest nicht in der Praxis, sondern sehr personenabhängig. Die Chirurgie ist auch nicht besonders familienfreundlich, man hat oft lange Operationen, auch nachts und am Wochenende. Deshalb habe ich mich für die Innere Medizin entschieden. Das Gebiet ist sehr vielfältig und man kann dort auch handwerklich arbeiten.
Haben Sie Ihre Facharzt-Prüfung schon hinter sich?
Nein. Eigentlich sollte ich in diesen Tagen meine Doktorarbeit auf einer Konferenz in Madrid vorstellen und danach meine Prüfung machen. Wegen der Corona-Krise verschiebt sich nun wohl beides.
Wann und wo haben Sie Deutsch gelernt?
In der Schule in Syrien habe ich Französisch gelernt. Zusätzlich habe ich privat Englisch-Kurse gemacht. Aber meine Eltern dachten, eine dritte Fremdsprache könnte praktisch sein. Deshalb haben sie mir, als ich zwölf war, eine Sprach-CD gegeben. So habe ich die ersten deutschen Wörter gelernt.
Im ersten Semester an der Uni habe ich meinen ersten Deutsch-Kurs gemacht, danach sporadisch weitere. 2011 konnte ich einen sehr guten Kurs am Goethe-Institut in Aleppo nutzen – aber das musste kurz darauf schließen, weil der Krieg begann.
Während des Studiums habe ich dann ein dreimonatiges Praktikum in Oldenburg gemacht. Im Operationssaal konnte ich nicht viel Deutsch lernen, aber im Studentenwohnheim und bei dem Sprachkurs in der Volkshochschule, den ich parallel zum Praktikum gemacht habe. So war ich bei meinem Berufseinstieg in Deutschland ganz gut vorbereitet.
Empfinden Sie heute bei der Arbeit noch Sprachbarrieren?
Fachlich so gut wie nie. Die Umgangssprache fällt mir manchmal schwerer, Witze zum Beispiel verstehe ich nicht immer. Aber meine Freundin ist Deutsche. Wir sind seit vier Jahren zusammen, das hat natürlich sehr geholfen.
Wurde Ihre Ausbildung hier gleich anerkannt? Wie liefen die Formalitäten ab?
Im Vergleich zu heute lief das damals noch unglaublich unkompliziert ab. Um ein Visum zu bekommen, reichte mir ein Uni-Abschluss und B2 Sprachniveau. Ich hatte dann mit dem Visum sechs Monate Zeit, um eine Stelle zu finden. In Deutschland habe ich dann meine Unterlagen über das Studium vorgelegt, die wurden geprüft und dann bekam ich meine Approbation, also die Zulassung, ganz ohne Prüfung. Das Ganze hat nur einen Monat gedauert.
Und wie ist es heute?
Sehr viel komplizierter. Ich kenne die jetzige Situation ja nur aus Erzählungen von Freunden und Kollegen. Aber demnach ist schon der erste Schritt schwieriger. Das Visum muss man jetzt bei der deutschen Botschaft im Libanon beantragen, in Syrien gibt es ja keine mehr. Die Situation dort war die letzten Jahre katastrophal: Man wartete mehrere Monate alleine auf einen ersten Termin und dann bis zu ein Jahr auf ein Visum.
Um ein Visum zu bekommen, braucht man allerdings einen sogenannten Defizit-Bescheid aus Deutschland. Die Botschaft versucht damit einzuschätzen, ob ein ausländischer Arzt später Chancen auf eine Stelle haben wird. Um so einen Bescheid zu bekommen, muss man aber die Approbation schon beantragt haben…
… okay, das klingt vertrackt…
… und um die Approbation beantragen zu können, muss man zunächst eine Fachsprachen-Prüfung gemacht haben. Um sich dafür anmelden zu können, braucht man wiederum die Interesse-Bekundung eines deutschen Arbeitgebers. Erst wenn man die Fachsprachen-Prüfung gemacht hat, bekommt man eine Berufserlaubnis für eine bestimmte Zeit in einem bestimmten Bundesland…
… ich verstehe…
… aber ohne Berufserlaubnis stellen die wenigsten Arbeitgeber eine Interesse-Bekundung aus. Es ist ein Teufelskreis. Man muss schon viel Glück haben, um ihn zu durchbrechen. In manchen ostdeutschen Bundesländern ist der Bedarf an Ärzten größer, deshalb hat man hier etwas bessere Chancen.
War Ihr Arbeitseinstieg an der Uniklinik Dresden einfach oder sind Sie auf Hindernisse gestoßen?
Das war sehr gut. Mein damaliger Chef war politisch engagiert. Er setzt sich bis heute für eine bunte, vielfältige Stadt ein. Dresden hat einen schlechten Ruf in Bezug auf Rechtsextremismus. Aber es gibt hier auch viele Menschen, die anders denken.
Gibt es Aspekte des deutschen Gesundheitssystems, die Sie überrascht oder verwundert haben?
Positiv hat mich die Stärke des Systems überrascht: Alle sind versichert. In anderen Ländern werden Patienten zuerst nach ihrer Kreditkarte gefragt. Hier wird in einem Notfall jeder Patient behandelt, selbst wenn er sich nicht mal ausweisen kann.
Diese Stärke kann aber auch zur Schwäche werden. Das System ist so reich, dass die Ärzte oft gar nicht mehr hinterfragen, ob teure Untersuchungstechniken oder Medikamente überhaupt nötig sind. In Aleppo muss meine Oma auf einfache Schmerzmittel lange warten. Es schockiert mich manchmal, wie verschwenderisch hier mit den Mitteln umgegangen wird.
Obwohl ich inzwischen auch oft so handele: Früher hätte ich mehr auf die klinische Untersuchung gebaut, heute ordne ich sofort ein CT oder MRT an, weil die Geräte eben da sind. Aber wir sollten uns schon bewusst sein, dass das der Luxus einer kleinen Minderheit auf der Welt ist.
Was gefällt Ihnen an Ihrer jetzigen Arbeit besonders gut?
Manche deutschen Kollegen meckern oft: zu wenig Urlaub, zu viel Arbeit, zu schlechte Bezahlung. Aber ich finde die Arbeitsbedingungen im Vergleich zu anderen Ländern gut. Ärzte können sich hier zum Beispiel Zeit für die Kindererziehung nehmen.
Toll ist auch das wissenschaftliche Potenzial. An der Uniklinik kann ich sehr akademisch arbeiten, aktuelle Verfahren ausprobieren, an Studien mitarbeiten. Als jemand, der aus einem viel weniger entwickelten Land kommt, ist es für mich großartig, an aktuellen Entwicklungen mit forschen zu können.
Über Abed Sarraf
Abed Sarraf, 30, kommt aus Aleppo in Syrien. Dort hat er 2014 sein Medizin-Studium abgeschlossen und ist danach nach Deutschland gekommen. Hier arbeitet er an der Uniklinik in Dresden in der Inneren Medizin.
(jk)